Optimismus? Wirklich?
Für viele klingt das erstmal irritierend – gerade in Führungsetagen. Wer Verantwortung trägt, muss Probleme sehen, Risiken benennen, Krisen managen. Optimismus scheint da fehl am Platz. Vielleicht sogar unprofessionell. Aber ist das wirklich so?
Tatsächlich ist Optimismus einer der zentralen Faktoren seelischer Widerstandskraft – und damit eine Ressource, auf die keine Führungskraft verzichten sollte. Vorausgesetzt, wir verstehen ihn richtig.
Optimismus ist nicht: „Alles wird gut“
Optimismus heißt nicht, Schwierigkeiten zu ignorieren. Sondern: anzuerkennen, dass sie da sind – und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass wir Einfluss nehmen können. Dass wir gestalten, statt nur zu ertragen. Optimismus bedeutet, sich inmitten des Sturms zu fragen:
„Was ist jetzt mein nächster sinnvoller Schritt?“
Diese Haltung verändert alles. Denn sie macht aus Betroffenen wieder Handelnde. Und genau das stärkt – auch und gerade dann, wenn keine schnellen Lösungen in Sicht sind.
Warum wir den negativen Dingen mehr Gewicht geben
Doch genau das fällt vielen schwer. Nicht, weil sie schwach sind – sondern weil unser Denken anders gepolt ist. Was schiefläuft, springt uns schneller ins Auge. Kritik bleibt länger haften als Lob. Zweifel wirken lauter als Hoffnung. Dieses Phänomen nennt sich Negativitätsverzerrung (Negativity Bias).

Wir Menschen nehmen Risiken und Gefahren schneller wahr als Chancen. Das ist kein Fehler, sondern eine Art „Sicherheitsmodus“ unseres Denkens. Doch in der heutigen Arbeitswelt, geprägt von Unsicherheit und Komplexität, kann genau dieser Fokus hinderlich werden. Er blockiert Perspektivwechsel, untergräbt Mut – und lässt uns übersehen, was bereits funktioniert.
Führungskräfte, die sich dessen bewusst sind, können aktiv gegensteuern. Indem sie gezielt den Blick auf Ressourcen lenken, Lösungen sichtbar machen und dem Team helfen, in Bewegung zu bleiben.
Beispiel aus dem Führungsalltag
Eine Bereichsleiterin in einem international tätigen Unternehmen steht vor einem Umstrukturierungsprozess. Die Stimmung im Team kippt: Sorgen, Frust, Widerstände machen sich breit. Gleichzeitig steigt der Erwartungsdruck von oben. Die Verunsicherung ist spürbar – und die eigenen Kräfte schwinden.
Was hier hilft, ist kein Durchhalteparolen-Optimismus, sondern ein strategischer Optimismus. Die Fähigkeit, das Team nicht in Schockstarre zu führen, sondern in Bewegung zu halten. Gemeinsam kleine Erfolge sichtbar machen. Ermutigende Narrative schaffen: „Wir haben Veränderungen schon gemeistert. Wir können das wieder.“
Solche Führung wirkt. Weil sie Hoffnung ermöglicht, ohne die Ernsthaftigkeit der Lage zu leugnen.
Kann man Optimismus lernen? Ja – und man sollte es.
Optimismus ist nicht angeboren. Er ist ein Denkstil, der sich trainieren lässt. Und wie bei jeder neuen Fähigkeit gilt: Es braucht Übung.
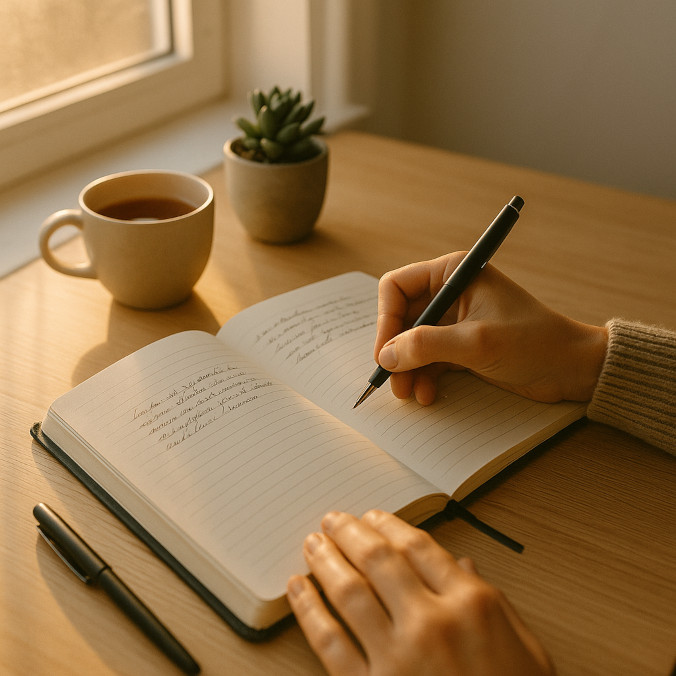
Eine einfache, aber eindrückliche Übung macht das deutlich:
Verschränke jetzt einmal deine Arme.
Und nun verschränke sie andersherum – also so, dass der andere Arm oben liegt.
Gar nicht so einfach, oder? Es fühlt sich ungewohnt an, vielleicht sogar unlogisch. Genau so ist es auch mit neuen Denkmustern. Unsere gewohnten Bewertungen, insbesondere die kritischen, laufen automatisiert ab. Optimistischer zu denken heißt, sich bewusst neu auszurichten – wieder und wieder.
Hilfreiche Fragen für den Alltag können sein:
- Was ist das kleinste Anzeichen, dass es besser werden könnte?
- Wem in meinem Umfeld gelingt der Umgang mit Ähnlichem – und was kann ich davon lernen?
- Woran werde ich erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind – auch wenn es noch ruckelt?
Solche Fragen verändern den inneren Fokus. Und sie helfen, aus dem „Krisenmodus“ in einen lösungsorientierten Zustand zu kommen. Mit jedem Perspektivwechsel wird das neue Denkmuster dabei etwas vertrauter.
Warum Optimismus in Unternehmen den Unterschied macht
Optimismus auf individueller Ebene ist kraftvoll. Noch wirksamer ist er, wenn er Teil der Unternehmenskultur wird. Wenn er sich zeigt in Führung, Kommunikation, Teamdynamik. In der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen – statt Schuldige zu suchen. In einer Atmosphäre, in der Entwicklung möglich ist, auch wenn der Weg nicht geradlinig verläuft.
Organisationen brauchen keine euphorischen Daueroptimisten. Aber sie brauchen Menschen, die an Bewegung glauben. Und an das Potenzial, das in ihnen und anderen steckt.
Ausblick:
Im nächsten Teil dieser Reihe geht es um Selbstregulation – und darum, wie wir auch unter Druck klar bleiben, mit Emotionen professionell umgehen und uns selbst innerlich stabilisieren.
